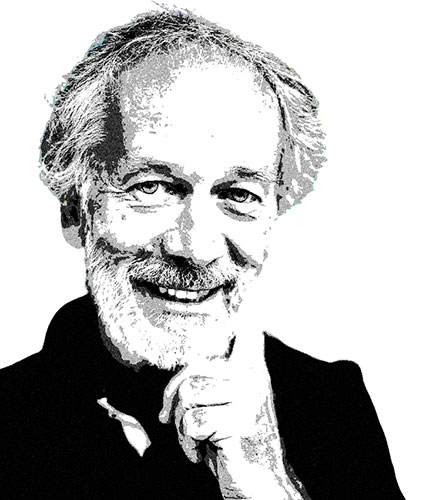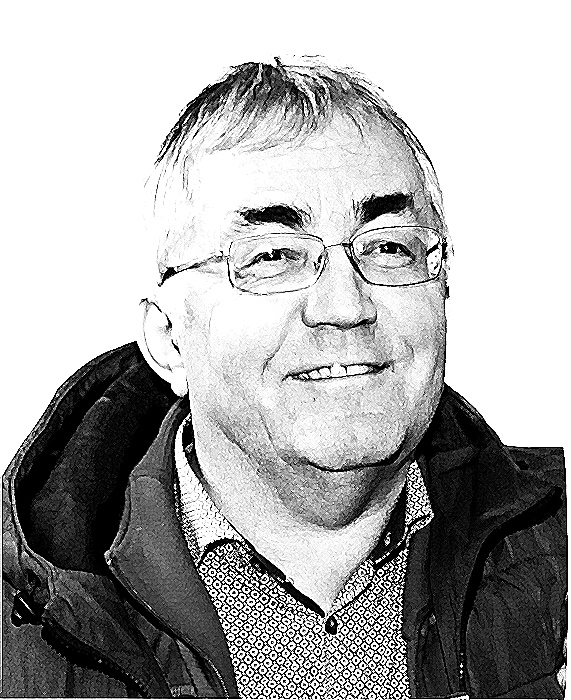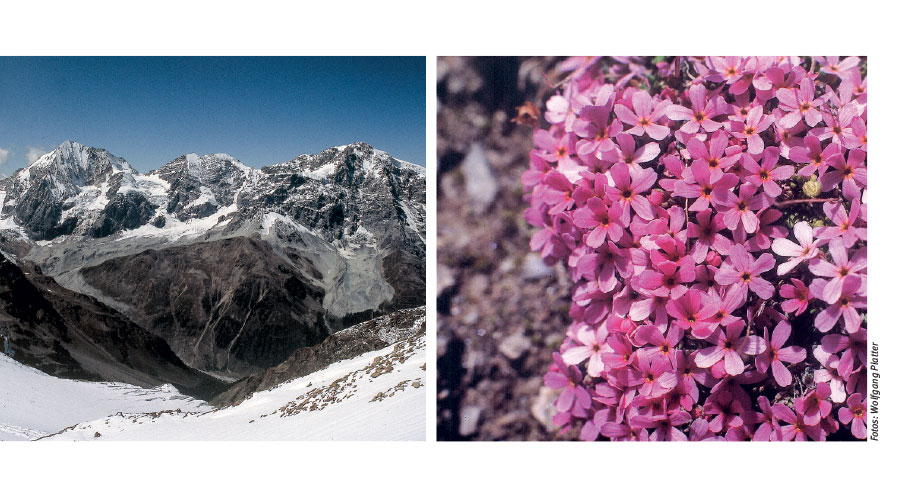Der „Wasser Max“
- Vorspann: „I gea mit der Ruat, um die Leit zu helfen“, sagt Max Pohl aus Tschengls. Er entdeckte durch Zufall seine Gabe zum „Wünschelrutengehen“. Er misst Baustellen oder Pläne mit seiner Wünschelrute oder seinem Pendel aus, und auf seine Aussagen hin wird gebaut oder eingerichtet.
- Dachzeile: Portrait
- Redakteur: Christine Weithaler
- Redakteur Bild:

Max Pohl ist 1959 in Tarsch geboren worden und hat 8 Geschwister. Seine Familie erfuhr erst vor kurzem von der Halbschwester, einer unehelichen Tochter seines Vaters, die in Dietenheim lebt. Groß war die Verblüffung und doch herzlich das Kennenlernen. Bei einem Besuch im Tarsch verabschiedete sich seine Halbschwester am Grab ihres Vaters. Das machte sie und Max sehr dankbar und glücklich.
Max wuchs in Tarsch auf und machte nach der Pflichtschule die Lehre als Maurer. Er wurde jung Vater und heiratete 1981 nach Tschengls. Er arbeitete in der Schweiz über 20 Jahre als Maurer und verlegte 15 Jahre lang Gipsplatten und dergleichen. Acht Winter fuhr er in Samnaun mit einem Schilift, welcher 180 Personen transportieren konnte. Er erinnert sich an einen Stillstand der Bahn. Max musste die Nerven bewahren, die Gäste beruhigen, obwohl er selbst nicht wusste, warum es zu dem Zwischenfall gekommen war und wann es wieder weitergehen würde. Gott sei Dank löste sich das Problem, und die Fahrt konnte fortgesetzt werden. Alle kamen wohlbehalten an. Max und zwei Kollegen pendelten täglich bei jedem Wetter mit dem Auto nach Samnaun. Sie überstanden manchen Schneesturm und blieben all die Jahre unfallfrei.
1992 entdeckte er zufällig seine Fähigkeit zum Gang mit der Wünschelrute. Er hielt einen Haselnusszweig in seinen Händen und vernahm eine Bewegung. Ein alter Wünschelrutengänger bekräftigte ihn in seinem Gespür, und so besuchte er Kurse auf dem Gebiet der atmosphärischen Strahlungen, der Wasseradern und Stromstrahlungen. Früher kannten die Menschen den Einfluss dieser Strahlungen. Heute wird dieses Wissen wieder entdeckt. Bei einem Besuch eines weltweit bekannten und geschätzten Wünschelrutengängers in Tschengls, bestätigte dieser, die Präzision der Gabe von Max. Die vielen Baustellen waren für den gelernten Maurer Übungsplatz. Immer wieder ging er Pläne mit der Wünschelrute ab, errechnete Tiefen der Wasseradern und erhielt beim Aushub der Baustellen die Bestätigung für die Richtigkeit seiner Angaben. Er wollte sich selbst von seiner Gabe überzeugen. Er übte und nahm Schwingungen bewusst wahr. Er untersucht mit verschiedenen Wünschelruten in Zusammenarbeit mit Naturheilpraxen oder Bio-Architekten unzählige Häuser in Südtirol, Österreich, Deutschland und der Schweiz auf Wasseradern. Auch unterirdische Gänge, versunkene Gräber, überschüttete Häuser macht Max ausfindig. Durch jegliche Bearbeitung des Bodens, der festen Erde entstehen Risse, die er mit der Rute erspürt. Besonders Kleinkinder und Tiere nehmen diese Risse, Strahlen war. Auch Bäume und Pflanzen können darauf ansprechen und verkrüppeln. Wasseradern oder Stromstrahlungen können auf das Nervensystem und den gesamten Körper des Menschen wirken. „Miar ärgert der Frevel und die Augenauswischerei dia mit dia gonzen Entstörgeräte gmocht wearn. Die Strohlungen und Wosserodern sein wou sie sein, mindern konn ma sie nit, man konnen ihnen lei ausstellen!“ Er erinnert sich an ein Kleinkind, das im „Bettstattl“ immer wieder den Kopf gegen das Gitter stieß, um den Strahlungen zu entkommen. Durch verschiedene Bewegungen, die die Rute beim Gang macht, kann Max sagen, in welche Richtung die Ader verläuft. Durch die Anzahl der Umdrehungen kann er die genaue Tiefe des Wassers bestimmen. Schaut man ihm dabei zu, sieht man seinen Respekt und seine Ehrfurcht vor seiner Gabe und vor der Natur. Er begibt sich so zu sagen in das Spannungsfeld, jede Messung zehrt an ihm. Früher hat er oft mehrere Gänge hintereinander gemacht, heute beschränkt er sie, seiner Gesundheit zuliebe auf zwei. „Es mocht mi ollm wieder glücklich, wenn i Leit helfen konn und sich ihre Lebensqualität durch mein Rot bessert!“ Immer wieder erreichen ihn Dankesnachrichten, dass sich Schlaf und Wohlbefinden nach dem Umstellen der Einrichtung, des Bettes, oder des Schreibtisches usw. in kurzer Zeit verbessert haben.
Seine Tochter und sein Sohn machten Max zum dreifachen Opa. Er genießt seinen Ruhestand, hilft seinem Sohn auf dem landwirtschaftlichen Betrieb in Tschengls. Im Winter drechselt er verschiedenste Hölzer zu Tellern, und im Sommer widmet er sich seinen Bienen. Der passionierte Imker bedauert, dass immer neue Bestimmungen und die Bürokratie das Hobby erschweren. Er möchte „nou a bissl gsund bleiben und so sein terfen wie er isch“, meint er, „Man soll sich im Leben nicht aus der Ruhe bringen lassen und s` Wichtigste und s` Beste für die eigene Gesundheit isch zufrieden zu sein“.
- Aufrufe: 52